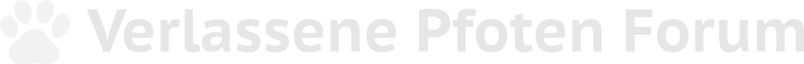Wir hatten es ja mehrfach angesprochen. Ich würde hier gerne Infos zum Thema "Angst beim Hund" sammeln.
Anfangen möchte ich mit meiner Zusammenfassung von einem Vortrag von Ute Blaschke-Berthold zum Thema "Strassenhunde", weil es viel zum Thema Angst behandelt- hatte es schon zweimal eingestellt (ist schon ein paar Jahre her):
Zunächst einmal fand ich Ute’ Einstellung zum Auslandstierschutz sehr sympathisch, da sie da sie in einigen Punkten auf meiner Linie ist.
Sie hat geäußert, dass sie nicht nachvollziehen kann, dass es Leute gibt, die meinen, man müsse zunächst Tieren in Deutschland helfen, bevor man welche importiert. Wir leben in der EU und einer globalen Welt. Sie hätte gerne einen anderen Begriff für Auslandshunde gehabt (ohne Ausland), da der Begriff an sich schon teilweise negativ besetzt ist und Vorurteile auslöst. Ich habe das etwas anders gesehen, da ich persönlich offen dazu stehe, dass meine Hunde „Ausländer“ sind und mein Herz in diese Richtung schlägt. Ich freue mich auch über jeden Hundehalter, der so tickt wie ich. So ist ja bei vielen Auslandshundebesitzern, deswegen gibt es ja auch zwei Suedi-Foren. Für mich sind die Suedis oder die Rumänen irgendwie besondere Hunde, für Ute sind es Hunde wie alle anderen auch.
Sie hat für ordentlichen Tierschutz plädiert und ehrliche Vermittlungen. Sie hat verständlich erläutert, dass zu starke Appelle an das Mitleid den Verstand ausschalten. So werden Tiere aufgenommen, obwohl der Verstand „Nein“ gesagt hätte. Das hat oft die Folge für das Tier, dass der Halter überfordert ist und das Tier zum Wanderpokal wird. Sie hat sich auch dagegen ausgesprochen zu wilde Hunde einzufangen und an ein Leben in einen Haushalt zu gewöhnen. Welpen dieser wilden Hunde sollten nach ihrer Meinung bis zum Alter von 4 Wochen an den Menschen gewöhnt werden, ältere Tiere sollten wieder ausgesetzt werden, auch wenn ihre Überlebenschancen gering sind.
Ute hat Hunde in vier Gruppen geteilt:
- Hausgebundene Familienhunde
- Wenig eingeschränkte Familienhunde (Streuner)
- Halb wilde Hunde (keine Eigentümer)
- Wilde HundeDie letzten drei Gruppen ordnet sie den Strassenhunden zu. Die Einteilungen Haushund, Strassenhund, wild lebender Hund nennt sie Schubladen, da es keine objektiven Merkmale zur Einsortierung bzw. Abgrenzung gibt.
Nach den ihr bekannten Zahlen haben wilde Hunde kaum Überlebenschancen, stehen immer kurz vor dem Hungertod, sind unfähig sich selbst durch Jagd zu ernähren. Es gibt sehr wenig Gruppen wilder Hunde auf der Welt.
Die Freiheit der Hunde hat einen hohen Preis. Je weniger Einschränkungen der Hund erlebt, desto höher sind in der Regel die Kosten für den Hund: unregelmäßige Nahrungsaufnahme, wenig sichere Ruheplätze, Strassen, der Mensch, Krankheiten, Beutegreifer
Die Sterblichkeit der Strassenhunde (oder wilden Hunde?) ist sehr hoch, über 45% im ersten Jahr. Nach weltweit zusammengefassten Zahlen beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung von Hunden, die in Städten leben 2,3 Jahre, bei Hunden im ländlichen Umfeld nur 1,1 Jahre.
Strassenhundpopulationen erhalten sich nicht von selbst, bekommen ständig Nachwuchs durch streunende Familienhunde- es sind keine natürlichen Populationen. In der Regel handelt sich um Mischlinge mit unterschiedlichen Erfahrungen.
Rein biologisch ist jeder Hund ein Produkt aus Genetik, Erfahrung und aktueller Umwelt. Strassenhunde haben in der Regel einen breiten genetischen Hintergrund, die Erfahrungen sind sehr unterschiedlich. Die gemachten Erfahrungen beeinflussen das Verhalten in der Zukunft. Typische Erfahrungen von Strassenhunden sind Angst (Verstecken und Wegrennen rettet das eigene Leben), Nahrungssuche, Beutefangverhalten und Ressourcenverteidigung. Alle diese Erfahrungen kann jeder Hund gemacht haben, bei Strassenhunden ist es aber oft aufgrund der gefestigten Erfahrung schwieriger das Verhalten umzustellen.
Ute misst der Vorgeschichte des Hundes wenig Bedeutung bei, weil die Vorgeschichte nur Erfahrungen in einer anderen Umwelt widerspiegelt und oft auch nur in Bruchteilen bekannt, teilweise vom Menschen verfälscht ist. Nach Ute’s Erfahrung kann die Vorgeschichte blind machen für die Gegenwart. Wichtig findet sie neutrale Infos über Erkrankungen (z.B. auch chronische Ohrenentzündungen), evtl. Beissvorfälle, Trennungsstress etc., damit die aufnehmende Pflegestelle oder der Halter schon durch entsprechendes Management Problemen vorbeugen kann. Rein biologisch entsteht Verhalten im Gehirn, die Erfahrungen wirken auf das Gehirn zurück: Rückkopplungsschleife. Über Regulationshormone (Stresshormone, Geschlechtshormone, Schilddrüsenhormone) wirkt das Verhalten auf Verhalten in der Zukunft. Deswegen sollte man unerwünschtes Verhalten möglichst verhindern und nicht zu oft auftreten lassen.
Nach Ute’ Erfahrungen und Kenntnissen haben Strassenhunde oft mehr Gepäck (Summe der Erfahrungen) als andere Hunde. Sie brauchen deswegen in der Regel viel mehr Zeit zur Eingewöhnung als z.B. deutsche Tierheimhunde. Die jüngste Vergangenheit der Strassenhunde ist geprägt vom Einfangen, medizinischer Versorgung und Kastration, Transport, Zwischenstation- dem Verlust aller Bindungen (Artgenossen, Ortsbindung, Klima). In der Regel hatten die Hunde auch andere Aktivitätszeiten (dämmerungs- und nachtaktiv).
Die Hunde unterliegen einem kompletten Kontrollverlust, dem stärksten Stressor, den es gibt. Hunde können neue Bindung aufbauen durch: Futter, sicheren Ruheplatz, Körperkontakt. Die Erfahrung zeigt, dass Hunde die Distanz halten und Berührung scheuen länger brauchen als Hunde, die Berührungen dulden. Das Konzept zur Eingliederung besteht aus drei Komponenten und sollte direkt nach dem Ortswechsel, also evtl. auch schon im Tierheim oder der Pflegestelle beginnen.
Erste Komponente
- Strukturen schaffen, Familienregeln und Management um Fehlverhalten zu verhindern (Hausleine, Kindergitter, Tisch abräumen, Türen sichern etc.)
- Verhalten beobachten und Stress- und Konfliktzeichen erkennen, mit hundlichem Verhalten wie Angst und Aggression rechnen
- Erwünschtes Verhalten bestätigen; setzt voraus zu wissen, wie der Hund belohnt werden kann (Futter, stimmliches Lob, variabel nach dem Bedürfnis des Hundes)
- weder positiv strafen (kann Angst auslösen, verstärken) noch negativ Bestrafung (löst Frustration aus)
- Grundübungen aufbauen
- nur kurze, reizarme Spaziergänge
- ruhiges Umfeld zu Hause, keine Besuche etc.Nach Utes’ Ansicht wird mit den meisten Strassenhunden viel zu früh, viel zu lange spazieren gegangen. Das Bewegungsbedürfnis der Hunde ist nachrangig, es kommt wenn die Hunde sich sicher fühlen, gut genährt sind etc. Reizüberflutung ist oft die Ursache von Stress, Übererregung und Angst.
Bei Angstverhalten sollte man nie - mit Futter näher an die Bedrohung locken - niemals in eine Situation zwingen - nach Möglichkeit negative Verstärkung nutzen Angstverhalten führt oft zu Aggressionsverhalten, wenn Meiden und Fluchtverhalten erfolglos sind.
Gute Erfahrungen hat sie bei Strassenhunde damit gemacht, die Futterrationen in drei Teile zu teilen: ein Teil aus dem Napf füttern, einen Teil suchen lassen, einen Teil als Belohnung fürs Training nehmen.
Als Trainingsmethode empfiehlt sie die differentielle Verstärkung (einfachste Trainingsmethode, funktioniert auch bei Hunden, die noch nichts können). Es wird Verhalten belohnt, dass der Hund zeigt und dass nicht unerwünscht ist. Beispiel: Hund sieht Jogger, ist ruhig, belohnen
Zweite Komponente
- mit dem Hund üben, stressende Situationen im vertrauten Umfeld aushalten zu können (z. B. Besuch, Kleinkinder etc.)
- Trainieren von Alternativverhalten: auf den Platz gehen und bleiben.
- Nähe fremder Personen tolerieren lernen
- Bewegungseinschränkungen tolerieren: Leine, Box, FesthaltenDie Gewöhnung (= Habitation) folgt biologisch bestimmten Regeln. Eine davon ist, dass eine Gewöhnung an etwas, dass zu bedrohlich ist, nicht erfolgen kann.
Dritte Komponente
- Umwelt erweitern (längere Spaziergänge) - Mehr Stimulationen Es ist nicht zu empfehlen, auf Spaziergängen den Hund fortwährend zu beschäftigen. Er soll seine Umwelt wahrnehmen, die Reize sollen aus der Umwelt kommen.Es ist wichtig, immer den Hund zu beobachten und zu testen, ob er noch ansprechbar ist (z.B. mit Namen anreden). Die Stimulation richtet sicher immer nach dem Tempo des Hundes. Langsame Hunde sollten nicht beschleunigt werden, bei hektischen Hunden Ruhe reinbringen. Man sollte immer den Hund beobachten und nach Tagesform vorgehen.
Für die Arbeit mit dem Hund empfiehlt Ute ein Trainingstagebuch, damit Fortschritte objektiv festgestellt werden können und bei Stillstand oder Verschlechterung das Training überdacht werden kann.